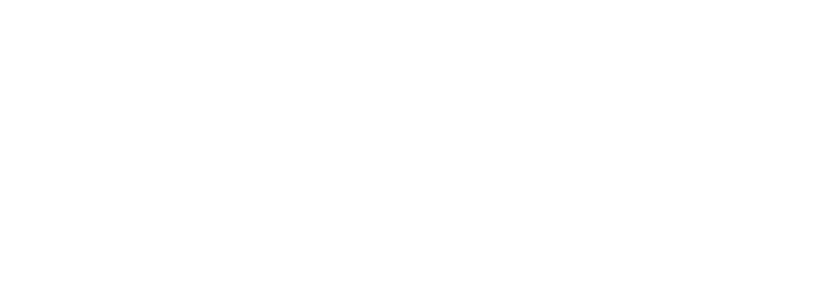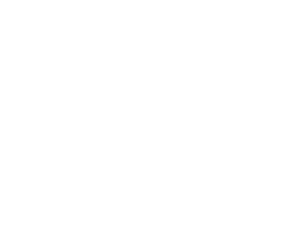PTBS
PTBS ist die Abkürzung für Posttraumatische Belastungsstörung. Oft wird auch die englische Abkürzung PTSD verwendet, die für Posttraumatic Stress Disorder steht. Eine weitere Bezeichnung für die PTSD ist die Traumafolgestörung. Unter diesen Bezeichnungen versteht man starke psychische Reaktionen, die auf ein außergewöhnlich belastendes Lebensereignisse zurückführen kann. Diese Reaktionen sind von einem wiederholten Wiedererleben der traumatischen Situation, emotionalem und sozialem Rückzug und nervlicher und körperlicher Überrerregtheit geprägt.
Ein Trauma mit nachfolgender PTBS ist wie eine Einkaufstasche oder ein Koffer, den man im Flur stehen lassen hat. Man fällt ständig drüber, bis man endlich alles weggeräumt hat. Während einer traumatischen Situation werden bestimmte Gehirnareale ‚abgeschaltet‘, so dass die Erfahrungen nicht mit einem Zeitstempel versehen abgespeichert werden können. So lauern die Erinnerungen von diesen Ereignissen hinter jeder Tür und lassen sie uns so erleben, als würden sie gerade jetzt stattfinden. Die Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung belasten das Leben der Betroffenen erheblich.
PTBS hat erhebliche Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen
Wie ein traumatisches Ereignis das Leben eines Menschen bestimmt, zeigt die Erfahrung von Rehana Webster (BSc). Als sie in Neuseeland mit rückfälligen Straftätern arbeitete, fiel ihr auf, dass diese Menschen alle traumatisiert waren. Zur Auflösung der Traumata kombinierte Sie verschiedene Techniken und entwickelte über die Jahre so ihre eigene Methode, die sich als außergewöhnlich effektiv herausstellte. Alle von ihr behandelten Straftäter wurden nicht mehr rückfällig. Im Umkehrschluss lässt sich daraus folgern, dass es die Traumafolgestörungen oder PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung) waren, die diese Menschen immer wieder zu selbstschädigenden Handlungen veranlasst haben.
 Eine Traumafolgestörung ist eigentlich eine Überlebensstrategie der Natur
Eine Traumafolgestörung ist eigentlich eine Überlebensstrategie der Natur
Warum werden manche Erfahrungen überhaupt anders verarbeitet als andere? Wenn die traumatischen Erinnerungen doch nur zu Unruhe, Schlaflosigkeit und Panikattacken führen und der Betroffene immer wieder angetriggert wird, das traumatische Erlebnis so zu spüren, als wäre er wieder mitten drin, wo ist dann der Nutzen? Ist der Natur da ein Fehler passiert oder gibt es einen Grund dafür? Um das zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, dass die Traumaverarbeitung im sogenannten Reptiliengehirn stattfinden. Das ist ein Teil des Gehirns, mit dem wir und unsere Vorfahren schon sehr lange herumlaufen – etliche Millionen von Jahren. Für ein Tier in freier Wildbahn ist es eben doch sinnvoll, wenn es nach einer lebensbedrohlichen Situation nur Anzeichen einer ähnlichen Situation wahrnehmen muss, um einen Schrecken zu bekommen, der es augenblicklich fliehen lässt. Alle Symptome der PTBS steigern so gesehen die Überlebenswahrscheinlichkeit in einer Umgebung, in der das Leben des Betroffenen unmittelbar bedroht ist. Besonders, wenn der Betroffene eine Eidechse, eine Maus oder eine Gazelle ist. Als Mensch haben wir unseren Verstand, mit dem wir Gefahren sehr gut abschätzen können. Außerdem müssen wir nicht ständig um unser Überleben kämpfen. Aber unser Reptiliengehirn weiß davon nichts und versucht uns daher, vor Gefahren zu schützen, die es nicht gibt.
Wie wird die posttraumatische Belastungsstörung definiert?
Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) gehört zur Gruppe der Anpassungs- und Belastungsstörungen. Es sind psychische Reaktionen, die eindeutig auf außergewöhnlich belastende Lebensereignisse zurückzuführen sind.
Wie wird eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert?
Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist eine psychische Erkrankung. Sie gehört zur Gruppe der Anpassungs- und Belastungsstörungen. Neben ihr zählt man noch die akute Belastungsreaktion und die Anpassungsstörung zu dieser Gruppe. Die akute Belastungsreaktion tritt unmittelbar nach dem Ereignis auf und dauert etwa 2-3 Tage. Im Volksmund kennt man sie als “Nervenzusammenbruch”. Symptome sind Betäubt sein, Empfindungslosigkeit, panische Angst, Schwitzen, Zittern, Unruhe, Überaktivität, Amnesie, depressive Symptome und sozialer Rückzug. Sie bildet sich meist ohne Therapie zurück, kann aber auch in eine posttraumatische Belastungsstörung übergehen. Eine Anpassungsstörung hat ihren Ursprung in einer veränderten Lebenssituation, z. B. bei Tod eines Angehörigen oder einem Kulturschock. Sie zeichnet sich durch Symptome wie depressive Stimmung, Angst und Besorgnis aus und beginnt innerhalb von 4 Wochen nach Änderung der Lebensumstände, hält aber nicht länger als 6 Monate an.
Eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) geht eindeutig auf eine traumatische Erfahrung zurück (posttraumatisch bedeutet „Nach einem Trauma“). Die Schwere ist abhängig von der eigenen Gefährdung und Betroffenheit, der erlebten Todesgefahr, der Nähe zum Täter und der Dauer. Von einer PTBS spricht man erst, wenn die Symptome länger als einen Monat anhalten. Eine ärztliche Untersuchung soll organische Ursachen für die Symptome ausschließen, bevor die Diagnose gestellt wird.
Was sind die Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung?
Die Leitsymptome einer PTBS sind
- sich aufdrängende Erinnerungen: wiederholtes Erleben der traumatischen Situation in der Vorstellung (Flashback) oder in Träumen
- Vermeidung ähnlicher Situationen
- emotionaler und sozialer Rückzug
- nervliche und körperliche Übererregtheit
Genauer unterteilt werden die PTBS-Symptome in
Phänomene der Intrusion (Wiedererleben):
- die belastenden Erinnerungen des Traumas drängen sich dem Betroffenen immer wieder auf
- Träume und Alpträume, die von dem belastenden Ereignis handeln
- spontanes Handeln und Fühlen wie während des traumatischen Ereignisses (Flashbacks)
- emotionale Beeinträchtigung durch alles, was mit dem Trauma in Verbindung steht (Menschen, Orte, Worte, Gegenstände, Aktivitäten, usw.)
- körperliche Reaktionen durch etwas, was mit dem Trauma in Verbindung gebracht wird
Veränderungen in Wahrnehmung und Stimmung
- Erinnerungslücken bezüglich des traumatischen Ereignisses
- das Gefühl, von sich selbst getrennt zu sein und sich wie von außen zu beobachten
- anhaltende oder wiederkehrende Erfahrungen einer Unwirklichkeit, verzerrt, fremd, wie im Traum
- negatives Selbst- und Weltbild
- anhaltende Gefühle von tiefer Verzweiflung, Angst, Panik, Wut, Schuld oder Scham
- Schuldgedanken sich selbst und anderen gegenüber
- andauernde Unfähigkeit, etwas Positives im Leben zu sehen
Veränderungen der Erregbarkeit und Reaktionsfähigkeit (körperliche Symptome)
- Hypervigilanz: übermäßige Wachsamkeit des Betroffenen, ständiges Überprüfen der Situation auf Anzeichen, die an das Trauma erinnern
- Übermäßig starke Schreckreaktionen
- Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren
- Schlafstörungen
- (Selbst-) aggressive Verhaltensweisen
Die ICD-10 (International Classification of Deseases) zählt die PTBS zu den psychischen Störungen und nennt zusätzlich noch folgende Symptome:
„Oft kommt es nach Traumatisierungen be dem Betroffenen zu einem Gefühl von emotionaler Abgestumpftheit, einem andauernden Gefühl von Betäubt-Sein, Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, einer Teilnamslosigkeit gegenüber der Umgebung im Allgemeinen. Die Vermeidung von Aktivitäten oder Situationen sowie Stichworten, die Erinnerungen an das Trauma hervorrufen können, ist oft das Ergebnis der Angst, welche mit dem Trauma verbunden ist.“
Bei wem tritt eine posttraumatische Belastungsstörung auf?
Früher nahm man an, dass nur bestimmte Menschen mit einer entsprechenden psychischen Vorbelastung an einer PTBS erkranken können. Heute weiß man, dass auch psychisch stabile Menschen in diese Krisenzustände geraten können, wenn sie traumatisierende Lebensereignisse durchleiden mussten. Wie eine traumatische Situation erlebt wird, scheint entscheidenden Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit und Schwere einer nachfolgenden PTBS zu haben. Dabei ist die eigene Gefährdung, erlebte Todesgefahr, Beziehung zum Täter und Dauer des traumatischen Geschehens von Bedeutung. Aber auch ältere Menschen und Menschen mit seelischen Vorerkrankungen und Erkrankungen im Allgemeinen sind anfälliger für eine PTSD. Resilienz ist hier wohl ein wichtiger Faktor – einigen Untersuchungen von Vergewaltigungsopfern zufolge entwickeln in dieser Gruppe etwa 35% eine PTBS.
 Wie wird eine posttraumatischen Belastungsstörung behandelt?
Wie wird eine posttraumatischen Belastungsstörung behandelt?
Die allererste Maßnahme muss natürlich sein, den Betroffenen vor weiteren Traumatisierungen zu schützen, ihn also gegebenenfalls aus dem traumatisierenden Umfeld herauszuholen. Es ist auch sinnvoll, den Betroffenen zuerst zu stabilisieren, bevor die traumatische Erfahrung aufgearbeitet wird. Das kann z. B. mit Entspannungsübungen oder in einer Kur geschehen. Auch entspannende und angstlösende Medikamente können kurzzeitig zum Einsatz kommen.
Nachdem der Betroffene ausführlich über die Erkrankung aufgeklärt worden ist, geht es in der Regel darum, dass er sich Schritt für Schritt mit seinen traumatischen Erlebnissen und den damit verbundenen Erinnerungen konfrontiert. Dadurch soll das Ereignis so in die Biographie eingeordnet werden, dass es durch das Bearbeiten in eine abgeschlossene Erinnerung verarbeitet werden kann. Ein wichtiger Aspekt bei der Behandlung von PTBS-Patienten ist die Gefahr der Retraumatisierung bei konfrontativen Techniken. Diese sollten deshalb nur von speziell ausgebildeten Traumatherapeuten durchgeführt werden.
Wirksame Traumabearbeitungsverfahren der Psychotherapie sind die kognitive Verhaltenstherapie, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) und Hypnotherapie nach Erickson. Diese Verfahren brauchen allerdings Zeit, und es besteht die Gefahr der Retraumatisierung. Neueste Erkenntnisse in der Traumaforschung (u.a. von Peter A. Levine, Stephen Porges, Bessel van der Kolk) haben gezeigt, dass nach Erkenntnissen über die neuronale Plastizität traumatische Erlebnisse auch schnell und vor allem sanft aufgelöst werden können.
 Wie entsteht eine posttraumatische Belastungsstörung?
Wie entsteht eine posttraumatische Belastungsstörung?
Eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) kann auch als Traumafolgestörung bezeichnet werden. Was ist nun ein Trauma? Eine traumatische Erfahrung ist jedes Ereignis, das in einem Menschen ein Gefühl von Ohnmacht, Hilflosigkeit und Kontrollverlust verursacht. Das kann ein schwerer Unfall, Machtmissbrauch, sexueller Missbrauch, Vergewaltigung oder eine Kriegserfahrung sein. Aber auch der Ausschluss aus einer Gruppe (Mobbing), eine herablassende Bemerkung im falschen Augenblick oder das Beobachten eines schockierenden Ereignisses können diese Gefühle auslösen und sind somit als traumatisch einzustufen. In so einer Situation werden bestimmte Gehirnareale ‚hochgefahren‘: die, die für eine automatische Reaktion benötigt werden und als Kampf-, Flucht- und Erstarrungsreflex bekannt sind. Andere Teile werden dagegen abgeschaltet: unter anderem die, die für das Abspeichern in das biographische Archiv zuständig sind. Solche ‚heimatlosen‘ Erinnerungen können nun jederzeit durch Ähnlichkeitsreize wachgerufen werden. Ohne die Archivierung fehlt das Gefühl von „das war damals und ist abgeschlossen und vorbei“. Die Erfahrung wird in aller Heftigkeit wiedererlebt und empfunden. Die Person leidet in Folge immer wieder unter dem gleichen Stress wie in der ursprünglichen Situation. Außerdem wird auch das Sprachzentrum deaktiviert, so dass die Worte fehlen, um das Erfahrene zu beschreiben.
Nach neuesten Erkenntnissen (Van der Kolk) braucht es für die Heilung eines Traumas eine Technik, die
- die aktivierten Gehirnareale beruhigen und die
- die abgeschalteten Gehirnareale aktivieren.
Genau das leistet TBT, eine Kombination aus Klopfakupressur und Elementen aus dem neurolinguistischem Programmieren (NLP).
 Wie lange dauert eine PTBS und was passiert, wenn sie nicht behandelt wird?
Wie lange dauert eine PTBS und was passiert, wenn sie nicht behandelt wird?
Eine posttraumatische Belastungsstörung tritt definitionsgemäß (nach ICD-10) innerhalb sechs Monaten nach dem traumatischen Erlebnis auf. In seltenen Fällen wurde allerdings auch schon ein Zeitraum von mehreren Jahren beobachtet, bevor es zum Ausbruch der PTBS kam. In dem Zeitraum zwischen dem Ereignis und dem Auftreten kann sowohl eine akute Belastungsreaktion liegen als auch völlige Beschwerdefreiheit. Halten die Symptome dann länger als vier Wochen an, spricht man von einer PTBS. In 50% aller Fälle bildet sie sich nicht von selbst ohne Therapie wieder zurück. Das heißt, dass es unbehandelt dann zu einer Chronifizierung kommt (30% aller Fälle werden chronisch) und auf Dauer auch Persönlichkeitsveränderungen oder die Erkrankung an einer Depressionen möglich ist. Somit kann das Leben der Betroffenen stark beeinträchtigt werden. Die Erfolgsaussicht einer Traumabehandlung ist hoch, die Dauer einer Behandlung und die Belastung, der der Patient bei der Behandlung ausgesetzt ist, hängt jedoch stark von der Behandlungsmethode ab.
Führend auf dem Gebiet der Traumaheilung
Peter A. Levine
Dr. Peter A. Levine ist einer der bedeutendsten Traumaforscher unserer Zeit. Alle seine Bücher sind internationale Bestseller, wobei „Sprache ohne Worte“ wohl den Höhepunkt Levines Lebenswerk darstellt. Seine Forschungen über Stress und Trauma, verbunden mit seiner therapeutischen Erfahrung und Erkenntnissen aus der aktuellen Gehirnforschung, Neurobiologie und integrativer Body/Mind-Medizin haben die konkrete Traumabehandlung weltweit vorangebracht. Nach Aussage Levines ist Trauma weder eine Krankheit noch eine Störung, sondern eine Verletzung, die durch lähmende Furcht und Gefühle von Hilflosigkeit und Verlust verursacht wurde. Sieht man die posttraumatische Reaktion als Teil eines hochintelligenten psychosomatischen Selbstschutzsystems, kann ein Trauma transformiert und aufgelöst werden, so Levine. Er plädiert dafür, die innewohnende Fähigkeit zur Selbstregulation von Traumafolgesymptomen wieder nutzen zu lernen, anstelle diese durch Unwissenheit zu blockieren.
Stephen Porges
Stephen W. Porges Polyvagal-Theorie der Emotionen hat sich in großem Maße auf die Art der Behandlung missbrauchter bzw. misshandelter Kinder und traumatisierter Erwachsener ausgewirkt. Porges Polyvagal-Theorie zufolge besitzen Säugetiere (und insbesondere Primaten) Gehirnstrukturen, die sowohl das Sozial- als auch das Defensivverhalten steuern. Diese Strukturen ermöglichen es dem Menschen, Emotionen auszudrücken, zu kommunizieren, sowie Beziehungen einzugehen und aufrechtzuerhalten. Die Polyvagal-Theorie lieferte neue Erkentnisse darüber, wie Interventionen Menschen mit sozialen, verhaltensbedingten und psychiatrischen Störungen helfen können. Porges betont die besondere Bedeutung des Gefühls der Sicherheit für den Heilungsprozess von traumatischen Störungen. Aus seiner Sicht ist ein Mangel an dem Gefühl der Sicherheit der entscheidende Aspekt bei der Entstehung und Heilung psychischer und physischer Krankheiten.
Bessel van der Kolk
Bessel van der Kolk ist seit über dreißig Jahren im Bereich der Traumaforschung und auch deren klinischen Praxis an vorderster Front aktiv. Somit gehört er zu den wichtigsten Pionieren der Erforschung und Behandlung von Traumata. Sein Buch „Verkörperter Schrecken“ist ein Grundlagenwerk, das Erkenntnisse der neurowissenschaftlich fundierten Traumaforschung mit den neuesten Entwicklungen aus dem Bereich der körperorientierten Therapien verbindet.
Van der Kolk zeigt auf, dass Traumata nicht nur bei Unfall- und Verbrechensopfern eine große Rolle spielen. Für ihn gibt sind auch die weniger offensichtlichen, aber gleichermaßen katastrophalen Auswirkungen sexueller und familiärer Gewalt und die verheerende Wirkung von Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung und Substanzabhängigkeiten von fundamentaler Bedeutung. Ihm zufolge stehen das Entsetzen und die Isolation im Zentrum eines jeden Traumas, welches buchstäblich Veränderungen im Gehirn und im Körper hervorrufen. Die unvorstellbaren Ängste, Taubheitsempfindungen und die unerträgliche Wut, die Probleme, sich zu konzentratieren, sich zu erinnern, Vertrauensbeziehungen aufzubauen – all das erklärt van der Kolk durch neue Erkenntnisse über die Überlebensinstinkte.
Er plädiert bei der Traumabehandlung für die Integration von Erkenntnissen aus den Bereichen der Gehirn- und Bindungsforschung sowie der Achtsamkeitsforschung, weil diese geeignet seien, die natürliche Plastizität des Gehirns zu aktivieren und so gestörte Funktionen zu reorganisieren und zu einem natürlichen Leben ohne ständige Angst zurückzukehren.
Rehana Webster
Rehana Webster, BSc (Biologie/Antropologie), ist die Entwicklerin der Trauma Buster Technique (TBT), eine mind-body-Technik zur Behandlung von Traumafolgestörungen. Sie ist eine von weltweit 28 EFT-Master-Practitioners (Emotional Freedom Techniques) und auch NLP-Master (Neurolinguistisches Programmieren). Webster hat 10 Jahre an der Verfeinerung ihrer Technik gearbeitet, in der sie Elemente aus diesen beiden Gebieten verbunden hat. Somit ist TBT eine Kombination aus dem Beklopfen gewisser Akupunkturpunkte und Formaten aus dem NLP. Webster kann mit ihrer Technik, deren Wirksamkeit sie durch Erkentnisse zur Plastizität des Gehirns erklärt, beeindruckende Erfolge bei der Arbeit mit traumatisierten Frauen und Kindern, Flüchtlingen, Haftinsassen und Soldaten vorweisen.
Die fast 70-jährige Australierin reist ehrenamtlich in Krisengebiete (Libanon, Jordanien und Pakistan), wo sie mit ihrer sanften Methode Betroffenen hilft, sich von ihren Traumafolge-Symptomen zu befreien.
Copyright Foto: Fotolia